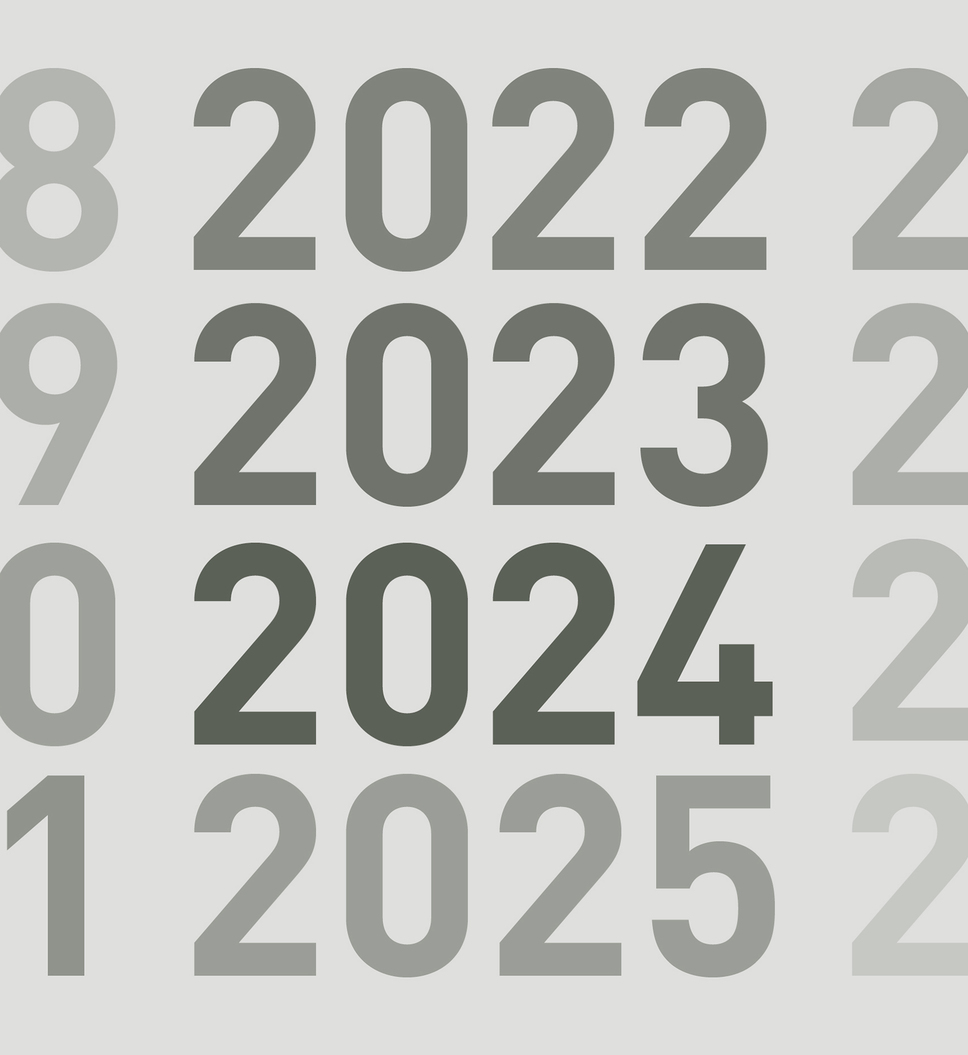
Den Informationsvorsprung für Ihre Entscheidungen nutzen
Seit vielen Jahren analysieren wir jährlich die Marktpotenziale, Chancen, Risiken und Perspektiven im Bereich Windenergie. Unsere Studien werden von zahlreichen Fachleuten und Brancheninsidern gelesen. Sie geben eine realistische Einschätzung der aktuellen Situation wieder und prognostizieren die zukünftige Entwicklung – eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage für alle Marktteilnehmer im Windenergiebereich.
Der Vergleich unserer Marktprognosen mit den tatsächlich erzielten Werten zeigt, wie realistisch wir die Situation und zukünftige Entwicklungen einschätzen. Dass der Markt ab 2020 langsam wieder wachsen würde, haben wir früh prognostiziert. So konnten sich alle unsere Kunden rechtzeitig auf die neue Situation einstellen. Mit unserer Vorhersage für 2023 lagen wir wieder genau richtig.
Aktuelle Ergebnisse der Ausschreibungen
Seit 2017 gibt es auch in der Windenergie Ausschreibungen, sowohl für Projekte an Land als auch auf See. Nachfolgend die aktuellen Ergebnisse der letzten drei Jahre.
Der Höchstwert für Ausschreibungen Wind an Land in 2024 wurde von der Bundesnetzagentur bei 7,35 ct/kWh belassen.
Bei der Ausschreibung am 1. Mai 2024 mit 2.795.480 kW kam es wieder zu einer Unterzeichnung, obwohl das Ausschreibungsvolumen bereits im Vorfeld durch die BNetzA von 4.093.587 kWh um 1.298.107 kWh reduziert wurde. Es wurden Gebote in Höhe von 2.379 MW bezuschlagt. Die bezuschlagten Gebote lagen zwischen 7,20 ct/kWh und 7,35 ct/kWh und der mengengewichtete, durchschnittliche Zuschlagswert bei 7,33 ct/kWh.
Die nächste Ausschreibung Wind an Land ist am 1. August 2024 mit einem Ausschreibungsvolumen von 4.093.587 kW. Es kann aber noch eine Reduzierung der Ausschreibungsmenge durch die Bundesnetzagentur wegen drohender Unterzeichnung erfolgen (endogene Mengensteuerung).
Der Höchstwert für Ausschreibungen Wind an Land in 2023 wurde von der Bundesnetzagentur auf 7,35 ct/kWh (+25 %, Vorjahr 5,88 ct/kWh) erhöht. In 2023 wurden bei den vier Ausschreibungen Wind an Land 6.377 MW bezuschlagt, nahezu die doppelte Menge als im Jahr 2022 (3.225 MW). Allerdings waren insgesamt 12.840 MW ausgeschrieben. Die Bundesnetzagentur hatte in den Ausschreibungen Mai, August und November 2023 aufgrund von drohenden Unterzeichnungen das ursprüngliche Ausschreibungsvolumen von jeweils etwa 3.200 MW schon auf 2.865 MW, 1.666 MW und 2.086 MW reduziert. Trotzdem kam es in allen Ausschreibungen zu Unterzeichnungen. Die mengengewichteten, durchschnittlichen Zuschlagswerte lagen zwischen 7,31 ct/kWh und 7,34 ct/kWh, also sehr nahe am Höchstwert.
Am 1. Juni 2023 gab es die erste Ausschreibung Wind Offshore für „Nicht zentral voruntersuchte Flächen (Nord und Ostsee)“ im „dynamischen Gebotsverfahren“. Drei Flächen für Offshore-Windparks mit einer Leistung von jeweils 2.000 MW in der Nordsee und eine Fläche in der Ostsee mit einer Leistung von 1.000 MW. Insgesamt wurden für die vier Projekte 12,6 Mrd. Euro geboten. Am 1. August 2023 gab es ebenfalls die erste Ausschreibung für „Zentral voruntersuchte Flächen (Nordsee)“ im „Gebotsverfahren mit qualitativen Kriterien“. Hier wurden ebenfalls vier Flächen mit insgesamt 1.800 MW ausgeschrieben. Die Erlöse aus der Ausschreibung beliefen sich auf 784 Mio. Euro. Beide Ausschreibungsergebnisse stellen einen Wendepunkt im Offshore-Bereich dar. Die Bieter müssen aktuell aufgrund der starken Wettbewerbssituation für die Standorte extrem hohe Entgelte zahlen, entgegen den 0 ct/kWh-Geboten in der Vergangenheit.
Die Bundesnetzagentur hatte den Höchstwert für Ausschreibungen Wind an Land in 2022 auf 5,88 ct/kWh reduziert. Insgesamt waren 5.332 MW ausgeschrieben, aber nur 3.279 MW konnten bezuschlagt werden. Es gab wieder eine Unterdeckung von 2.053 MW (-38,5 %). Die mengengewichteten, durchschnittlichen Zuschlagswerte lagen zwischen 5,76 bis 5,87 ct/kWh. Am 1. September gab es eine Ausschreibung für Offshore-Windenergie in der Nordsee (980 MW). Der Zuschlagswert lag wieder bei 0 ct/kWh. Die Ausschreibungsergebnisse setzten die Entwicklung zu förderfreien Offshore-Windparks fort.
Der Höchstwert in 2021 wurde auf 6,0 ct/kWh festgelegt. Insgesamt wurden in 2021 Wind an Land 4.235 MW ausgeschrieben und nur 3.295 MW bezuschlagt. Es gab damit eine Unterdeckung von 939 MW (-22,2 %). Die mengengewichteten, durchschnittlichen Zuschlagswerte lagen zwischen 5,79 bis 6,0 ct/kWh. Am 1. September gab es die einzige Ausschreibung für Offshore-Windenergie. Gegenstand der Ausschreibung waren zwei Flächen in der Nordsee (658 MW) und eine in der Ostsee (300 MW). Die Zuschlagswerte lagen bei 0 ct/kWh.
Vergleich unserer Markprognosen zum Zubau Wind an Land mit den Ist-Werten
- Prognose 2023: 3.200 MW
- Ist-Wert 2023: 3.567 MW
- Differenz: +367 MW (+11,5 %)
- Prognose 2022: 2.500 MW
- Ist-Wert 2022: 2.403 MW
- Differenz: -97 MW (-4 %)
- Prognose 2021: 2.500 MW
- Ist-Wert 2021: 1.925 MW
- Differenz: -575 MW (-23 %)
- Prognose 2020: 1.500 MW
- Ist-Wert 2020: 1.431 MW
- Differenz: -69 MW (-5 %)
Einführung
Aktuelle Markteinschätzung zur Windenergie 2024 in Deutschland
(Stand 03/2024)
Die Aufstellungszahlen im Jahr 2023 in Deutschland haben sich weiter erhöht, da der Markt wieder wächst. Mit der Errichtung von 745 Windenergieanlagen (WEA) an Land und 27 Offshore-Windenergieanlagen (OWEA) und einer neu installierten Leistung von 3.824 MW wurde eine Steigerung von 39,3 % gegenüber dem Vorjahr (2.745 MW) erzielt. Die am Netz befindliche Windenergieleistung konnte damit von 1991 bis Ende 2023 von 108 MW auf 61.010 MW an Land und 8.465 MW auf See gesteigert werden. Mittlerweile drehen sich in Deutschland mehr als 28.677 WEA an Land und 1.566 OWEA auf See. Im Jahr 2023 produzierten die installierten Windenergieanlagen 139,8 Terrawattstunden (TWA). Das entsprach etwa 27,0 % der deutschen Bruttostromerzeugung.
Die seit Anfang Dezember 2021 amtierende Bundesregierung (Koalition aus SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP) hat am 11.01.2022 durch ihren Vizekanzler und Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck in einer Pressekonferenz die Eröffnungsbilanz Klimaschutz vorgelegt und die neuen Ziele definiert.
Nachfolgend Zitate aus der Pressekonferenz:
Habeck betonte: „Wir wollen bis 2045 klimaneutral werden und bis 2030 den Anteil Erneuerbarer Energien auf 80 Prozent steigern. Die Arbeit dafür hat begonnen. Die prioritären Gesetze, Verordnungen und Maßnahmen setzen wir jetzt aufs Gleis – ein erstes Klimaschutz-Paket kommt bis Ende April, ein zweites im Sommer.“
Ziel des Klimaschutz-Sofortprogramms ist es, alle Sektoren auf den Zielpfad zu bringen und die erforderlichen Maßnahmen in die Wege zu leiten, damit Deutschland seine Klimaziele erreichen kann. Alle dafür notwendigen Gesetze, Verordnungen und Maßnahmen sollen bis Ende 2022 abgeschlossen werden. Damit dies gelingt, wird die Bundesregierung die Erstellung und Umsetzung des Programms konsequent vorantreiben.
Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck machte deutlich: „Das alles ist eine Mammutaufgabe. Und es wird einige Jahre dauern, bis wir die Erfolge sehen werden. Aber das, was wir jetzt machen, legt die Grundlage dafür, Klimaschutz und Wohlstand zusammenzubringen.“


Zu den Sofortmaßnahmen, die das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz zeitnah vorlegen wird, gehören unter anderem:
EEG-Novelle: Wir stellen im EEG die Weichen für 80 Prozent erneuerbare Stromerzeugung bis 2030. Dafür erhöhen wir die Ausschreibungsmengen. Die technologiespezifischen Mengen werden anwachsend ausgestaltet, von Anfang an von einem sehr ambitionierten Niveau ausgehend. Dabei wird ein Bruttostromverbrauch in der Mitte des Korridors aus dem Koalitionsvertrag (680–750 TWh) unterstellt, also 715 TWh. Wir werden den Grundsatz verankern, dass der EE-Ausbau im überragenden öffentlichen Interesse ist und der öffentlichen Sicherheit dient.
Windenergie: Wir erschließen kurzfristige Flächenpotenziale für Wind an Land und beschleunigen mit einem Wind-an-Land-Gesetz den Ausbauprozess. Wir werden die Abstände zu Drehfunkfeuern und Wetterradaren reduzieren und Maßnahmen für eine bessere Vereinbarkeit des Windausbaus mit militärischen Interessen umsetzen. Hier schlummern große Flächenpotenziale. So sind im Bereich Funknavigation und Drehfunkfeuer 4 bis 5 GW Leistung möglich. Zusätzlich gibt es ein Potenzial von 3 bis 4 GW Leistung im Bereich militärischer Belange. Mit dem Wind-an-Land-Gesetz werden wir zwei Prozent der Landesfläche für Windenergie reservieren, den Windenergieausbau mit dem Artenschutz versöhnen und die Voraussetzungen für zügigere Planungs- und Genehmigungsverfahren schaffen.
Und der Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck hat in 2022 u. a. „geliefert“:
Der Deutsche Bundestag hat am 7. Juli 2022 vier umfassende Gesetzespakete zum Ausbau der erneuerbaren Energien beschlossen, um die Klimaziele der BRD und der Europäischen Union zu erreichen und die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern zu reduzieren. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG 2023 wurde novelliert und verabschiedet und Ende Dezember 2022 durch die Europäische Kommission beihilferechtlich genehmigt. Am 1. Januar 2023 ist es in Kraft getreten.
Zitate aus dem EEG 2023:
§ 1 Ziele
Ziel dieses Gesetzes ist insbesondere im Interesse des Klima- und Umweltschutzes die Transformation zu einer nachhaltigen und treibhausgasneutralen Stromversorgung, die vollständig auf erneuerbaren Energien beruht.
Zur Erreichung des Ziels nach Absatz 1 soll der Anteil des aus erneuerbaren Energien erzeugten Stroms am Bruttostromverbrauch im Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutschland einschließlich der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone (Bundesgebiet) auf mindestens 80 Prozent im Jahr 2030 gesteigert werden.
Der für die Erreichung des Ziels nach Absatz 2 erforderliche Ausbau der erneuerbaren Energien soll stetig, kosteneffizient, umweltverträglich und netzverträglich erfolgen.
§ 4 Ausbaupfad
Die Ziele nach § 1 sollen erreicht werden durch
1. eine Steigerung der installierten Leistung von Windenergieanlagen an Land auf
a) 69 Gigawatt im Jahr 2024,
b) 84 Gigawatt im Jahr 2026,
c) 99 Gigawatt im Jahr 2028,
d) 115 Gigawatt im Jahr 2030,
e) 157 Gigawatt im Jahr 2035 und
f) 160 Gigawatt im Jahr 2040
sowie den Erhalt dieser installierten Leistung nach dem Jahr 2040,
2. eine Steigerung der installierten Leistung von Windenergieanlagen auf See nach Maßgabe des Windenergie-auf-See-Gesetzes, …
Insgesamt sind Neuerrichtungen von Windenergieanlagen an Land im Zeitraum 2023 bis 2030 von 58.000 MW geplant. Um diese Ziele zu erreichen, wurde in 2023 das Ausschreibungsvolumen durch die Bundesregierung von ursprünglich 4.000 MW, um weitere 8.840 MW, auf 12.840 MW erhöht.
Den Offshore-Bereich regelt das ebenfalls novellierte Windenergie-auf-See-Gesetz (WindSeeG). Mit dem auf 30 GW (vorher 20 GW) erhöhten Ziel für 2030 und dem neuen 70 GW-Ziel (vorher 40 GW) für 2040 kann die Windkraft auf See als das Fundament der Energiewende einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele in Deutschland leisten.
Darüber hinaus wurden das Gesetz zur Erhöhung und Beschleunigung des Ausbaus von Windenergieanlagen an Land (Windenergie-an-Land-Gesetz – „WaLG“) sowie zentrale Normen für die Vorhabengenehmigung im Bundesnaturschutzgesetz („BNatSchG“) beschlossen.
Seit 01.01.2023 gilt das neue EEG 2023 mit verbesserten Konditionen für die „Südregion“ und die BNetzA hat den Höchstwert in 2023 auf 7,35 ct/kWh (+25 %) angehoben. Im Jahr 2024 wurde der Höchstwert bei 7,35 ct/kWh belassen.
Am 03.03.2023 hat der Bundestag und Bundesrat die Regelungen zur Umsetzung der EU-Notfallverordnung (Verordnung EU2022/2577) final beschlossen. Die Notfallverordnung erlaubt Ausnahmen von Verfahrensschritten, um EU-weit für einen Schub beim Ausbau erneuerbarer Energien zu sorgen.
Zitat: „Zusammen mit der Reform des EEG im vergangenen Jahr, der Anhebung der Höchstsätze in den Ausschreibungen für Wind- und Solarenergie und einer Reihe von weiteren Änderungen haben wir den Weg für die Beschleunigung freigeräumt“, so Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck. Die Bundesländer und die Genehmigungsbehörden hätten nun die gesetzlichen Grundlagen, um den Erneuerbaren-Ausbau, aber vor allem den Windkraftausbau mit voller Kraft voranzutreiben und Anlagen zügig zu genehmigen. „Ich bin sicher, dass sie das jetzt auch tun werden, schließlich liegt die dreifache Dringlichkeit auf der Hand: Die Erneuerbaren sind Klimaschutz, sie sind eine Standortfrage, sie bedeuten Sicherheit“, so Habeck weiter.
Am 23.05.2023 hat der Minister auf dem zweiten Windkraftgipfel die „Wind-an-Land Strategie“ der Bundesregierung vorgestellt. Demnach sollen unter anderem mehr Flächen bereitgestellt, qualifizierte Fachkräfte gezielter gewonnen und der Transport von Windkraftanlagen beschleunigt werden. Zwölf Handlungsfelder wurden vereinbart. Das vorgestellte Maßnahmenpaket wurde ebenfalls positiv von der Branche aufgenommen.
Seit 2017 gibt es auch in der Windenergie Ausschreibungen, sowohl für Projekte auf See als auch an Land. Die Ergebnisse waren für viele Akteure sehr überraschend, da die Preise für Wind auf See in den Ausschreibungen meist auf 0 Cent gefallen waren. Bei den letzten beiden Ausschreibungen im Juni und August 2023 lagen die Zuschlagswerte nicht mehr bei 0 Cent, sondern es mussten aufgrund der starken Wettbewerbssituation hohe Entgelte für die Standorte geboten werden.
In der letzten Ausschreibung Wind an Land im Februar 2024 wurden 2.486 MW ausgeschrieben, aber nur etwa 1.800 MW an Geboten wurden abgegeben und bezuschlagt. Es kam zu einer Unterzeichnung, obwohl der Höchstwert in 2024 von der Bundesnetzagentur auf 7,35 ct/kWh belassen wurde und die Realisierungs- und Pönalfristen bei Windenergieanlagen an Land des EEG 2023 § 36e von 30 auf 36 Monate verlängert wurde. Im Februar lag der niedrigste Zuschlagswert bei 7,25 ct/kWh, der höchste bei 7,35 ct/kWh und der mengengewichtete, durchschnittliche Zuschlagswert bei 7,34 ct/kWh.
Das Thema Repowering nimmt in Deutschland einen immer höheren Stellenwert ein. Im letzten Jahr konnten von den neu errichteten 745 WEA bereits 225 als Repowering-Anlagen identifiziert werden. Das entspricht einer Leistung von 1.076 MW und einem Repowering-Anteil von etwa 30,2 % am Brutto-Zubau des Jahres 2023. Diese Entwicklung wird sich in den nächsten Jahren weiter beschleunigen, da nur begrenzte Windvorrangflächen zur Verfügung stehen und diese optimal durch neueste Anlagentechnik genutzt werden sollten.
Aufgrund des teilweise starken Wachstums der Windbranche wurden der Betrieb und Service der errichteten Anlagen teilweise vernachlässigt. Es mangelte an dem notwendigen Fachpersonal und teilweise auch an einer vernünftigen Ersatzteilversorgung seitens der Hersteller. Immer mehr Betreiber fordern deshalb eine professionelle Betreuung, die eine hohe technische Verfügbarkeit der Anlagen gewährleistet. Zwar hat sich die Situation grundsätzlich verbessert, aber in diesem Bereich müssen weiterhin erhebliche Anstrengungen unternommen werden, um einen wirtschaftlichen Betrieb der Anlagen über die angestrebte Lebensdauer von mindestens 25 bis 30 Jahren sicherzustellen.
Zurzeit werden in Deutschland onshore primär Anlagen der 4,5-MW- bis 5,0-MW-Klasse mit Rotordurchmessern von 136 bis 141 m aufgestellt. Für diese Anlagengrößen liegen teilweise Erfahrungswerte vor, so dass die Stör- und Ausfallanfälligkeit dieser WEA reduziert werden konnte. Um die Fehlerfrüherkennung zu verbessern und damit größere Schäden zu vermeiden, werden verstärkt Zustandsüberwachungssysteme erfolgreich eingesetzt. Die Entwicklungsdynamik in der Anlagentechnik ist weiterhin hoch, bedingt auch durch den starken Preisverfall bei den Anlagenpreisen in den Jahren 2018 bis 2020.
Für Standorte mit nur schwachen bis mittelstarken Windaufkommen, also primär im Binnenland, werden verstärkt Windenergieanlagen mit bis zu 150 m Rotordurchmesser und Nabenhöhen bis 165 m angeboten. Wie sich diese Anlagen in der Praxis langfristig verhalten werden, ist noch nicht absehbar, da nur bedingt Erfahrungswerte vorliegen. Dass ein schnelles Upscaling der Windenergieanlagen auch erhebliche Risiken für alle Beteiligten mit sich bringt, musste Siemens-Gamesa (SG) bei seinen neu entwickelten Serien 4.X und 5.X gerade schmerzlich feststellen. Viele der bereits errichteten Anlagen haben Schäden bei Rotorblättern und Getrieben. SG sah sich aufgrund der vielen technischen Probleme (Konstruktionsfehler?) im Herbst 2023 sogar gezwungen, den Neuverkauf dieser Anlagentypen erst einmal zu stoppen. Der Gesamtschaden soll sich auf mehr als 3 Milliarden Euro belaufen. Aber nicht nur die neuen Windenergieanlagen von SG haben erhebliche Problem, sondern auch viele Betreiber von neuen GE-Anlagen sind sehr unzufrieden und teilweise extrem genervt.
Neben den ersten Prototypen/Testanlagen mit 15 MW+ Nennleistung (für die spätere Offshore-Nutzung) wurden in den letzten Jahren Serienanlagen von Vestas mit 10,0 MW, Siemens Gamesa mit 11,0 MW und GE mit 13,0 MW offshore errichtet.
In den letzten 25 Jahren ist in Deutschland eine Vielzahl hoch spezialisierter Windkraftprojektierer entstanden. Dabei übernehmen diese Firmen nicht nur die Projektierung, sondern sind oftmals auch für die spätere Verwaltung bzw. Betriebsführung der Windparks verantwortlich. In diesem Bereich sind aktuell etwa 160 bis 170 Unternehmen primär tätig, die mehr als 10.000 Mitarbeiter beschäftigen. In der gesamten Windbranche werden in Deutschland Stand 2022 mittlerweile mehr als 124.200 Mitarbeiter (Windenergie an Land = 94.100, auf See = 30.100) beschäftigt. Das ist allerdings gegenüber dem Rekordjahr 2016 mit etwa 160.000 Beschäftigten ein erheblicher Rückgang (-22,4 %). Das ist sicherlich eine Folge der verfehlten Energiepolitik der alten Bundesregierung und speziell vom ehemaligen CDU Wirtschafts- und Energieminister Peter Altmaier (2018 bis Ende 2021) mit entsprechend katastrophal niedrigen Errichtungen von neuen Windenergieanlagen in den einzelnen Jahren.
Die Aussichten für die deutschen Projektentwickler für die nächsten Jahre sind weiterhin gut. Wir gehen in Deutschland an Land für 2024 von 3.900 MW Brutto-Zubau an Windenergieleistung aus. In 2025 werden die Errichtungszahlen stark steigen und sich in den darauffolgenden Jahren weiter kontinuierlich erhöhen. Auf See gehen wir in diesem Jahr von zwei Projekten mit 720 MW aus, die neu ans Netz gehen werden. Offshore geht es mit dem Ausbau erst wieder 2025 verstärkt weiter.
Die Marktaussichten in der deutschen Windbranche werden sich weiter stark verbessern. Die Konsolidierung der Branche ist abgeschlossen, und es steht ein neuer, langfristiger Wachstumsschub bevor, der voraussichtlich im Jahr 2025 die ehemaligen Höchstwerte aus dem Jahr 2017 (mehr als 6.000 MW Brutto-Zubau) erreicht. Die neue rot-grün-gelbe Bundesregierung hat den festen Willen, die Energiewende konsequent fortzuführen und möglichst schnell Klimaneutralität in Deutschland zu erreichen. Daneben hat der kriegerische Überfall von Putin/Russland auf die Ukraine, ein Staat mitten in Europa, zu einer „Zeitenwende“ geführt. Eine Reduzierung bis zum totalen Importverbot von russischem Gas und Öl soll so schnell wie möglich in ganz Europa erreicht werden.